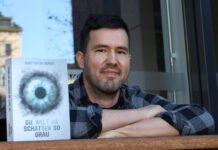Es war die berühmte Liebe auf den ersten Blick, diese Sache zwischen Leipzig und Martina Hefter. „Ich wollte auf jeden Fall hier leben“, erinnert sie sich noch immer gern an die allererste Begegnung in den Neunzigerjahren – da war sie auf dem Weg zum Aufnahmegespräch am Deutschen Literaturinstitut. Die Liebe ist frisch geblieben bis zum heutigen Tag: „Jedes Mal, wenn ich im Hauptbahnhof aus dem Zug aussteige, habe ich dieses Gefühl des Ankommens und Wohlfühlens.“
Diese Erlebnisse des Ankommens hatte sie des öfteren in den vergangenen Wochen und Monaten. Genauer gesagt, seit dem Oktober vergangenen Jahres – da wurde ihr Roman „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Und damit ganz schön schlagartig in das Licht der Öffentlichkeit gerückt, was wiederum gesteigertes Interesse nach sich zog.
Mit Interviews und vor allem Lesereisen, die ihrerseits für aufregende Begegnungen sorgten. „Ich mag dies – zum einen, weil ich da in Städte komme, die ich noch nicht kannte“, überlegt Martina Hefter und ergänzt: „Und ich mag die Gespräche bei den Lesungen.“
Der Vorteil einer ganz anderen Perspektive
Weil sie manchmal dann doch eine andere Perspektive eröffnen auf das preisgekrönte Buch. Auf die Geschichte der Mittfünfzigerin Juno Isabella Flock, die ein Doppelleben zwischen realem Alltag und digitaler Love-Scamming-Leidenschaft führt. „Das ist schon spannend: Gerade jüngere Menschen haben sich sehr für diese Sicht auf das Leben von Älteren interessiert – was vielleicht auch daran liegt, dass diese Älteren in der öffentlichen Wahrnehmung schon ein wenig abgekoppelt sind vom gesellschaftlichen Leben.“

Diese – nun ja – erlebbare Diskrepanz und gefühlte Distanz zwischen Generationen ist wohl einer der gewichtigen Gründe für den Erfolg von „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“: Zumindest hat Martina Hefter dies schon vor dem Buchpreis-Verleihung wahrgenommen, „schon die Buchpremiere war ausgebucht“.
Dabei schien eigentlich die Sache mit den Großstädten schon mal vorbei zu sein. Damals in den erwähnten Neunzigerjahren, als sie der freien Tanzszene in Berlin den Rücken kehrte. In einer (persönlichen) Krise half nur die Flucht, die Flucht zurück ins Allgäu (geboren ist Martina Hefter in Pfronten – dazu später mehr).
„Dort habe ich in einem Fitnessstudio gearbeitet. Auf der Suche nach Normalität“, erzählt sie. Und davon, dass trotzdem eine Leerstelle geblieben ist: „Das ist dann der existenzielle Moment mit der einen Frage: Möchte man das, was man gerade tut, sein ganzes Leben lang weiter tun? Also habe ich angefangen, einer Freundin Briefe zu schreiben. Und von ihr kam wiederum die Anregung: Du schreibst so schön, mach das mal weiter!“
Und dann half der Zufall
Womit der gute alte Zufall in Form einer „Spiegel“-Ausgabe seinen Auftritt hatte – dort stieß sie auf einen kleinen Artikel über das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig. „Ich wurde auf meine Bewerbung tatsächlich zu einem Aufnahmegespräch eingeladen. Und da habe ich eine derartige Freude empfunden, die ich bis dahin nicht kannte“, womit der Boden bereitet war für die eingangs angesprochene Liebesbeziehung. Die hat in den vergangenen gut drei Jahrzehnten auch schon eine Menge Früchte getragen.

In Form von „Junge Hunde“ beispielsweise, dem ersten Roman von Martina Hefter, erschienen im Jahr 2001. Ein Buch, in dem die Stadt Leipzig eine ganz schön gewichtige Rolle spielte – als Kulisse und Handlungsort. Was auch wiederum etwas damit zu tun hatte, dass sie als – nun ja – „Wessi“ eine ganz andere Perspektive kennengelernt hatte in Leipzig. Nach der Heirat mit Jan Kuhlbrodt, dem – nun ja – „Ossi“ aus Karl-Marx-Stadt: „So bin ich in eine Familie gekommen, die diesen Background und die Lebenserfahrungen der DDR haben. Und an Menschen, die in der Wendezeit in Leipzig studiert haben.“
„Ich mag diesen Kosmos Theater“
Zweiter wichtiger Halt: Die Theaterszene in Leipzig. Oder genauer gesagt das Schauspiel im Herzen der Messestadt. Denn dieser Punkt ist ziemlich wichtig: Martina Hefter ist eben nicht nur eine Schriftstellerin (und Lyrikerin – ebenfalls ein bedeutender Fakt), sondern auch Tänzerin, Performancekünstlerin und Choreografin. „Ich mag diesen Kosmos Theater“, sagt sie und erklärt: „Einfach, weil man da immer mit guter Laune und Offenheit empfangen wird. Und das Wunderbare am Theaterspielen ist das Spiel. Das Spielen macht Freude.“
Was dann wohl auch ein wenig geholfen hat, mit diesem Buchpreis-Erfolg umzugehen. Mit diesem neuen Scheinwerferlicht. Einfach weitermachen als Devise: „Nach der Preisverleihung bin ich am Montag gleich wieder zu den Proben gegangen. Bloß nicht groß nachdenken über die ganze Sache“, sagt sie mit einem Lächeln. Eine Investition, die sich gleichfalls lohnen sollte: Das Stück „Soft War“ – für das sie im Oktober gleich wieder auf der Probenbühne tanzte – räumt gut ab im Leipziger Schauspiel. „Das war schon eine echt erfüllende Zeit.“
Die gleichzeitige Leidenschaft für die Bühne und das Schreiben kennt Martina Hefter übrigens schon von Kindesbeinen an. Sie erinnert sich noch gut daran, zur Musik aus dem Radio getanzt zu haben. Mit Lust an der Bewegung und – na klar – am Spiel. „Ich fand es immer schön, einen eigenen Rhythmus und eine eigene Ausdrucksweise zu haben“, erzählt sie: „Auch Humor musste und muss immer sein. Das kommt wahrscheinlich von meiner Oma: Die hatte schon eine sehr ausgeprägte Berliner Schnauze.“
Die Wechselwirkung von Bühne und Schreiben
Diese Gleichzeitigkeit wirft Fragen auf – wieviel Choreografin steckt in der Schriftstellerin? Und umgekehrt? Durchaus herausfordernde Fragen – mit einem Versuch der Antwort. „Ich schreibe beispielsweise selten in chronologischer Abfolge“, überlegt Martina Hefter und ergänzt: „Hier spielt dann für mich das Stilmittel der Choreografie schon eine große Rolle: Wann kommt was? Was lasse ich weg?
Und wie kann ich es vielleicht auch wieder einsetzen? Ja, das hat schon viel mit dem Theater zu tun.“ Dennoch gilt eines ganz grundsätzlich: „Das Theater hat etwas Direktes und Unmittelbares: Da hat man sein Publikum ganz zentral bei seiner Kunst dabei. Der Prozess des Schreibens ist schon ein anderer als eine Inszenierung auf der Bühne.“
Das verbindende Element: Der direkte Zeitbezug. Ganz gleich, ob auf der Bühne oder am Schreibgerät – es geht ihr um das Andocken an das Hier und Jetzt. An den manchmal auch anstregenden Alltag zwischen harter Pflege und prekären Verhältnissen wie beispielsweise in „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ „Klar, da geht es um künstlerischen Anspruch und der muss zeitgenössisch sein“, überlegt sie – was wiederum seine Auswirkungen auf den eigenen Stil hat. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen, wohlgemerkt.
„Tatsächlich interessiert mich die Entwicklung von Figuren nicht so sehr. Da habe ich einfach einen anderen literarischen Ansatz – was wohl auch meiner Arbeit als Lyrikerin geschuldet ist“, erklärt sie: „Die Abstraktion ist schon ganz bewusst angelegt in dem Buch. Auch das Schemenhafte – in dieser Hinsicht kann ich mit der entsprechenden Kritik ziemlich gut leben.“
Roman-Projekt ist liegen geblieben
Wobei das allzu intensive Zurückblicken nun auch nicht unbedingt die Sache von Martina Hefter ist. Es muss ja schließlich weitergehen – wie mit den Proben nach dem Peak der Buchpreis-Verleihung. Ideen und Ansätze gibt es genug – da gibt es Lyrisches, an dem sie arbeitet. Und ein Roman-Projekt, liegen geblieben aus den Zeiten der Corona-Pandemie: „Da habe ich inzwischen das Gefühl, das will einfach raus.“ Womit ein ganz anderes Thema in den Blickpunkt rückt: Die Natur. Als Fluchtpunkt zum Beispiel. Aber auch als eine Realität, die eben auch längst nicht mehr natürlich, sondern vom Menschen gemacht ist.
„Ich stamme ja aus einem ziemlich klassischen Touristenort“, berichtet Martina Hefter vom Aufwachsen in Pfronten im Ostallgäu: „Und da habe ich live miterlebt, wie mehr und mehr der Schnee im Winter ausgeblieben ist. Das Ende von Pfronten als Wintersport-Ort.“ Nach einer Pause erzählt sie eine weitere, kleine, aber sehr persönliche Geschichte, die bis heute (nach-)wirkt: „Ich habe im Jahr 1985 meinen ersten Erdrutsch in meiner Heimat erlebt. Damals hat es das Haus meines damaligen Freundes erwischt. Da stellt sich dann schon die Frage: Was passiert mit unserer Welt?“
Die Dringlichkeit in der künstlerischen Arbeit
Woraus sich dann wiederum eine gewisse Dringlichkeit ergibt. Denn bei aller sprachlichen Reduktion und Abstraktion (ein Einfluss auch von Jenny Erpenbeck), bei aller Lust am Spielerischen und auch am Surrealen (das kommt von Adelheid Duvanel, sagt Martina Hefter) – eines ist ihr ganz wichtig: „Es darf nicht beliebig sein. Und es muss sich öffnen für ein Publikum: Es muss verständlich sein. Doch, ja, ich möchte verstanden werden.“
Womit sich wohl ein wenig der Kreis wieder schließt zu dem ersten Aha-Erlebnis in Leipzig. Zum Aufnahmegespräch am Deutschen Literaturinstitut, dem erfolgreichen, wohlgemerkt. Denn neben „neuen und alten Freundschaften“, die sie mitgenommen hat von diesem Institut, ist es vor allem dieses Selbstbewusstsein, das nachhaltig wirkt. Sie habe gelernt, dass es so viele unterschiedliche Formen des literarischen Schreibens gibt. Und alle ihre Berechtigung haben.
„Ganz ehrlich: Früher hätte mich so etwas nicht getraut – ich schreibe einen Text und dann veröffentliche ich den auch“, sagt sie mit einem Lächeln. Inzwischen weiß sie: „Es benötigt Ausdauer. Man darf sich einfach nicht entmutigen lassen. Dinge brauchen nun einmal ihre Zeit. Außerdem kann man Kreativität kann man nicht in ein Korsett pressen. Manchmal muss man Dinge auch zulassen. Oder sich auch mal ein wenig treiben lassen. Inzwischen habe ich gelernt, damit gut umzugehen. Letztlich muss man auch ein Scheitern einfach einmal zulassen können.“ Jens Wagner